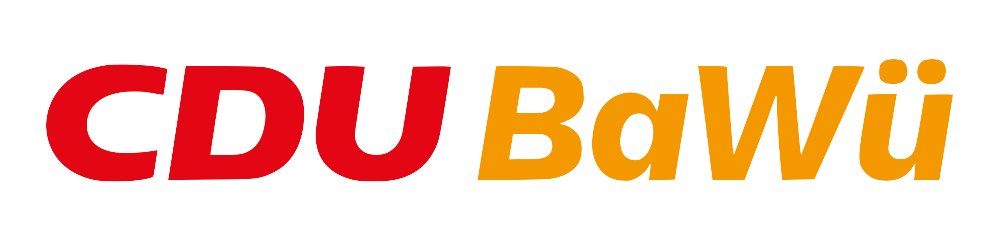Zur Lage der Menschenrecht in Zeiten künstlicher Intelligenz
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie im Namen des Landtags recht herzlich zu unserer Veranstaltung am Vorabend des Tags der Menschenrechte.
Den 10. Dezember begehen wir ja seit 1948, seit der Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen alljährlich als Erinnerung an diesen geschichtlichen Meilenstein. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier im ifa zu Gast sein dürfen, lieber Herr Grätz. Mit dieser Kooperation des Landtags mit dem Institut Francais und dem Institut für Auslandsbeziehungen erhält unsere heutige Debatte passend zu den universal gültigen Menschenrechten eine länderübergreifende Perspektive.
Lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede aber einmal nicht länder- sondern zeitübergreifend blicken. Lassen Sie uns gemeinsam in zwei Richtungen schauen:
- Einmal in die Zukunft.
- Und einmal in die Vergangenheit
Beginnen wir mit der Vergangenheit:
70 Jahre ist es nun her, dass der damalige Präsident des Parlamentarischen Rats, Konrad Adenauer, in Bonn das Grundgesetz unterzeichnete. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten sich ein halbes Jahr zuvor, im September 1948, zur Konstituierung des Parlamentarischen Rats im Museum König eingefunden – einem recht skurrilen Ort für den Auftakt zur Erarbeitung einer Verfassung. Denn in diesem zoologischen Museum standen überall Tierexponate. Sie waren notdürftig mit Vorhängen abgetrennt oder mit Tüchern bedeckt den Blicken der Versammlung entzogen. Provisorischer ging es kaum. Und doch hat das Grundgesetz, genau wie die zuvor verabschiedete UN-Menschenrechtscharta, Bestand. Bis heute garantieren sie zentrale Rechte; sie markieren die Grundpfeiler unserer Gesellschaft, die großen Freiräume, aber auch die Grenzen unseres demokratischen Diskurses.
Kontrastieren wir dies einmal mit einem Blick in die Zukunft:
Wie sähe unser Grundgesetz aus, wenn es nicht vor, sondern erst in 70 Jahren entworfen werden würde? Wenn seine Verfasser nicht umgeben von ausgestopften Tieren, sondern umgeben von Robotern ihre Arbeit aufnehmen würden? Wenn seine Verfasser in einer dieser düsteren Zukünfte – in sogenannten Dystopien – leben würden, die uns die Literatur bisweilen zeichnet? Wäre noch Raum für das Brief- und Fernmeldegeheimnis in einer Welt allgegenwärtiger „Big-Brother“-Überwachung wie in George Orwells Roman „1984“? Gäbe es noch den Schutz von Ehe und Familie in dem staatlichen Erziehungsregime von Huxleys „Schöner Neuen Welt?“ Müsste man die unantastbare Menschenwürde auch auf Roboter ausdehnen, wenn sie zur Kreativität, ja sogar zur Liebe fähig wären, wie in dem zeitgenössischen Roman „Maschinen wie ich“ von Ian McEwan?
Und manchmal wirken diese Dystopien und diese Fragen sogar jetzt schon ganz nah:
- Den Turing-Test, 1950 von dem Briten Alan Turing entwickelt, um herauszufinden, ob Maschinen genauso echt wie Menschen kommunizieren können, haben erste Bots schon lange bestanden.
- Die KI hat uns im Schach, im japanischen Brettspiel Go, im Computerspiel Dota, im Poker geschlagen.
- Die Alexa von heute verdient vielleicht noch keine Menschenrechte, dringt aber mikrofonausgerüstet in unsere intimste Privatsphäre vor.
- In der Stuttgarter Zeitung vom vergangen Freitag konnten wir lesen, dass an einem Roboter gearbeitet wird, der Trost spendet und Menschen dazu in zwölf verschiedenen Varianten in den Arm nehmen kann – offensichtlich sind Computer auch zu emotionaler Intelligenz fähig.
- Und selbst meine Aufgabe hier gerade als Grußwortrednerin ist schon maschinell ersetzbar: Letztes Jahr brachte IBM den „Project Debater“ heraus, der politische Reden halten kann.
Also: Müssen wir nun angesichts der Zukunft alle in Panik verfallen? Ich möchte entschieden antworten: Nein. Zum einen: Ohne zu bestreiten, dass die technologischen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte enorm sind – ganz so schnell wie in den Romanen geht es dann doch nicht.
- Der Roman „1984“ ist eben nicht 1984 Realität geworden.
- Und auch von Huxleys „Schöner neuen Welt“ scheinen wir, zumindest in Europa, noch Lichtjahre entfernt zu sein.
- Oder, um das Genre zu wechseln: 2001 gab es noch keine Odyssee im Weltraum, wie in dem gleichnamigen Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1968 phantasiert wird
Wir haben also Zeit, gemeinsam die Weichen zu stellen. Und daran schließt sich zweitens an: Es tut sich etwas – wie auch dieser Abend hier zeigen soll. Menschen machen sich Gedanken, wie das Zusammenspiel zwischen unseren alten Grundwerten und unseren zukünftigen Technologien gelingen könnte. Ich will Ihnen das demonstrieren, indem ich Sie auf eine kleine gedankliche Reise durch Deutschland mitnehmen möchte:
Beginnen wir in Berlin.
- Im Bundestag hat im letzten Jahr die Enquete-Kommission KI ihre Arbeit aufgenommen. Politik und Wissenschaft suchen dort gemeinsam Antworten auf die großen Fragen: Wie wird KI unser Leben verändern? Welche Freiräume, aber auch welche Regeln braucht sie?
- Außerdem: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat das Jahr 2019 zum „Wissenschaftsjahr KI“ Wir haben daher verschiedenste Veranstaltungen zu diesem Thema in den vergangenen Monaten erlebt.
- Und um noch in Berlin zu verweilen: Auch das vor wenigen Wochen eröffnete Futuriumversucht, den Bürgerinnen und Bürgern die Zukunft ganz plastisch vor Augen zu führen und sie zum Nachdenken und Mitmachen anzuregen. Ich kann nach einem eigenen Besuch dort nur empfehlen: Schauen Sie sich das Futurium bei Gelegenheit einmal an. Es lohnt sich wirklich.
- Gehen wir aber weiter von Berlin an die deutsch-französische Grenze: Deutschland und Frankreich bündeln aktuell ihre Kräfte in der KI-Forschung. Sie vernetzen ihre KI-Kompetenzzentren, um sich gemeinsam in diesem Forschungsfeld führend aufzustellen. Ich freue mich sehr über dieses Projekt der deutsch-französischen Zusammenarbeit.
- Und schließlich können wir gedanklich zu uns nach Baden-Württemberg weiterwandern:
- Denken wir an das Cyber Valley, das zwischen Stuttgart, Tübingen und Karlsruhe entsteht.
- Denken wir an unsere Automobilindustrie, die vorne mit dabei ist, wenn es um Forschung und Entwicklung zum autonomen Fahren geht
- Denken wir überhaupt an die vielen Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in unserem Bundesland
Oder schlagen wir den Bogen zu unserem heutigen Abend „Hat Alexa Menschenrechte?“
Dieser Titel spiegelt einerseits das Aufeinanderprallen von alten, und doch so fundamentalen Grundwerten sowie neuen Technologien. Er reiht sich andererseits – das hat unsere kleine Gedankenreise eben ja bezeigt – ein in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft über unsere Zukunft.
Wir freuen uns daher sehr auf Beiträge unserer Gäste, zuerst von Alexander Mankowsky. Sie sind, lieber Herr Mankowsky, als Zukunftsforscher bei der Daimler AG ganz konkret mit technischen und ethischen Fragen zu unserer Mobilität der Zukunft konfrontiert. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Impuls „Ethics by Design“. Herzlichen Dank für Ihr Kommen! Besonders herzlich darf ich Herrn Prof. Dr. Graßhof begrüßen. Er ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit letztem Jahr Präsident des Verwaltungsgerichts Stuttgart und Präsident des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg. Als derart hochrangiger Jurist passen Sie, lieber Herr Graßhof, ganz besonders gut zu einer Debatte über Menschenrechte und Sie fühlen sich ausdrücklich dazu aufgerufen ist, sich über unser Recht und die neue Künstliche Intelligenz Gedanken zu machen. Für Ihren Impuls haben Sie den Titel „Künstliches Recht, intelligentes Recht und das Recht der künstlichen Intelligenz“ gewählt. Ich danke Ihnen noch einmal sehr herzlich dafür, dass Sie heute ganz kurzfristig einspringen. Wir haben nämlich erst letzten Donnerstag erfahren, meine Damen und Herren, dass Frau Professorin Blandin-Obernesser auf Grund der Streiks nicht aus Frankreich anreisen kann. Und wir freuen uns nicht zuletzt auf Frau Professorin Christiane Riedel. Sie sind, liebe Frau Riedel, die Geschäftsführerin des ZKM, des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, das dieses Jahr sein 30. Bestehen gefeiert hat. Das ZKM ist eine Institution, die ausdrücklich mehr sein möchte als ein Museum – es ist ein Forum für alle Formen der Kunst und Kultur, mit einer klaren Perspektive ins digitale Zeitalter. Ich freue mich außerdem sehr, dass wir Frau Dr. Susanne Kaufmann, Redaktionsleiterin bei SWR 2 und spezialisiert auf Kunst und Kultur heute als Moderatorin für die Debatte zwischen unseren vielversprechenden Impulsgebern gewinnen konnten. Liebe Frau Dr. Kaufmann: herzlich willkommen!
Meine Damen und Herren, ich hoffe Sie sehen: Unsere Zukunft muss nicht so düster werden, wie in den Dystopien der Weltliteratur. Wir müssen uns nicht von den technologischen Innovationen überrollen lassen, sondern können – gerade auch an Abenden wie diesem heute – aktiv überlegen, wie wir diese neuen Entwicklungen mit unserem bestehenden Wertekanon verbinden können und wollen. Denn: Unsere Zukunft schreiben nicht Orwell und Huxley. Sondern: Unsere Zukunft schreiben wir selbst.