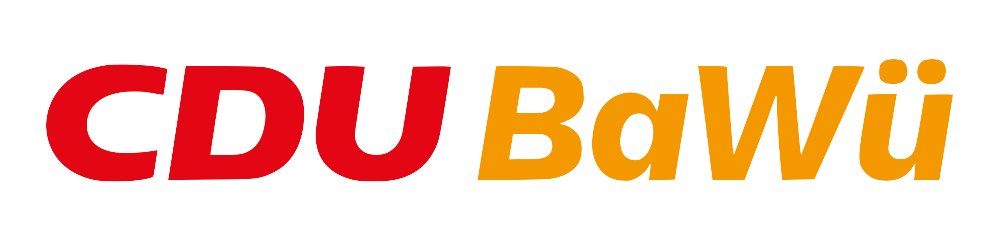Festrede 50 Jahre Christian-Wagner-Gesellschaft
Wenn man in Stuttgart einen kleinen Garten pachten möchte, muss man theoretisch 35 Jahre lang warten, bis man erfolgreich ist. Aber derzeit lohnt sich auch das Warten nicht. Man kann sich gar nicht anmelden, denn die Warteliste wurde aktuell bei 4000 Anmeldungen geschlossen. In anderen Städten sieht es ähnlich aus. In Ludwigsburg beispielsweise ist die Liste mit 1000 Personen voll, aber nur 15 Pächter wechseln pro Jahr.
Ich habe das beobachtet, weil mir als Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum der Gartenbau sehr nahe liegt. Aber auch, weil wir ja bei unserem Christian-Wagner-haus einen schönen kleine Garten haben.
Das Land fördert ja unsere Landesgartenschauen mit besonderen Förderprogrammen ganz intensiv. Und in die Vorbereitungen zur Bundesgartenschau, die nächstes Jahr in Mannheim stattfinden wird, bin ich selber eingebunden. Unsere Gartenschauen verzeichnen enorme Besucherzahlen und auch daran zeigt sich: Die Rückbesinnung der Menschen auf Natur und Umwelt steht hoch im Kurs und hat mit der Coronapandemie nochmals Fahrt aufgenommen.
Dazu kommt: Viele Menschen wollen sich regional ernähren, kaufen im Hofladen oder auf dem Wochenmarkt ein, bauen selber Obst, Gemüse und Kräuter an. Gerade in den Städten sehnen sich Menschen nach Natur und Selbstversorgung. Die einen erfüllen sich diesen Traum auf einem kleinen Balkon, die anderen beteiligen sich an solidarischer Landwirtschaft und manche hoffen eben auf die Möglichkeit, einen Schrebergarten pachten zu können.
Und sicherlich sehnen sich sehr viele Menschen heute nach all dem, was Christian Wagner in der gerade erst beginnenden schwäbischen Industrialisierung des ausgehenden 19. Jahrhunderts noch vor Augen hatte und so wunderbar in Worte gefasst hat. Nach einer Welt ohne Feinstaub und CO2, ohne Trockenheit oder Flutkatastrophen. Wir alle, so denke ich, stimmen Christian Wagners Topos von der Schonung alles Lebendigen aus vollem Herzen zu – ein Begriff, der geradezu perfekt ja auch zu unseren heutigen Debatten um das Tierwohl passt. So modern ist Christian Wagner also auch heute.
Meine Damen und Herren, das Thema „Garten“ erlaubt mir noch eine andere Annäherung an „Christian Wagner“. Ich habe nämlich dieses Jahr zum ersten Mal den „Mia-und-Hermann-Hesse-Garten“ am Bodensee, in Gaienhofen auf der Höri, besucht. Ich bin sicher, einige von Ihnen kennen dieses Kleinod. Ein Nutz- und Ziergarten mit großzügigem Wohnhaus, letztendlich erbaut mit dem Geld von Hesses erster Ehefrau Maria, genannt „Mia“, einer Schweizerin, einer Fotografin, die mit ihrer Schwester ein eigenes Atelier in Basel unterhielt, was sie wegen der Eheschließung aufgab. 1904 bis 1923 war sie mit Hermann Hesse verheiratet. 1907 zogen sie in dieses Haus
In dieses Haus, in dem dann auch Luise Wagner, Christian Wagners Tochter, als Hausmädchen arbeitete, wie Sie, lieber Herr
Kuhn, ja herausgearbeitet haben. Eben dieser Garten und dieses Wohnhaus wurden von den heutigen Eigentümern mit Hilfe eines Förderervereins und Zuschüssen des Landes wieder originalgetreu nachgebildet und kultiviert.
Die Besitzer haben den Garten nach alten Plänen rekonstruiert. Dort wachsen wieder wie zu Hesses Zeiten Wildkräuter, Obst und Gemüse, aber auch herrliche Blumen und Sträucher. Man kann auf zierlichen Wegen zwischen den Beeten laufen und alles bewundern. In diesem Garten ahnt man, in welcher Natur Hesse Inspiration für seine Arbeit suchte. Und warum er zu Christian Wagner aufschaute, der mit noch größerer Leidenschaft und größerem Sachverstand über noch größere und wilde Natur schrieb.
Bei seinen Erläuterungen zu Haus und Garten von Hermann Hesse war der heutige Besitzer allerdings nicht nur gut auf Hesse zu sprechen. Im Gegenteil: hinsichtlich seines Privatlebens hob er hervor, wie egozentrisch und auf seine eigene Künstlerkarriere bedacht er gewesen sein soll. Nach neueren Erkenntnissen hat er sämtliche Arbeiten im Haus und für die Familie seiner Frau überlassen, die sich dabei vollkommen überanstrengte. Als sie später depressiv wurde, hat er ihre Einweisung in die
Psychiatrie vorangetrieben und dann extra verlängern lassen, damit er sich leichter von ihr scheiden lassen konnte.
Meine Damen und Herren: Ich bin keine Hesse-Expertin und möchte jetzt keinesfalls eine Diskussion über einen unserer berühmtesten Literaten vom Zaun brechen. Aber der Nobelpreisträger Hesse und der „dichtende Bauer“ Wagner werden ja oft literarisch miteinander verglichen. Und wenn man ihre Privatleben und ihren Charakter bzw. das, was wir davon wissen, vergleicht, finde ich: da kommt Christian Wagner wesentlich besser weg.
Jedenfalls musste ich bei meinem Besuch in Gaienhofen an unsere Christian-Wagner-Gesellschaf denken. Es war der privaten Initiative einiger Hesse-Liebhaber zu verdanken, dass das Haus wieder restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Auch das Christian-Wagner-Haus hier in Warmbronn war in den 1970er-Jahren in einem überaus schlechten Zustand. Heute ziert es Warmbronn als echtes Schmuckstück. Da haben viele mitgewirkt und mitgeholfen.
Mir scheint, Sie lieber Herr Kuhn, Sie haben ein Faible für alte Häuser – denn soweit ich weit, geht auch die Renovierung des Gebäude des Galerievereins in der Zwerchstraße in Leonberg, maßgeblich auf Ihre Initiative zurück.
Die Leistung der CWG geht aber weit über das Gebäude hinaus, meine Damen und Herren:
- Sie haben dafür gesorgt, dass der Name „Christian Wagner“ nicht in Vergessenheit gerät, indem sie mit zahlreichen Veranstaltungen, Preisen, Wettbewerben an ihn erinnern.
- Sie haben sich besonders auch der Bildung von Jugendlichen verschrieben und eine Zeitlang mit Schulen rund um den Christian-Wagner-Dichterpfad zusammengearbeitet.
- Die CWG hat durch Neuausgaben dafür gesorgt, dass Wagners literarisches Werk nicht verloren geht oder in gekürzten Fassungen entstellt wird.
- Sie haben durch unermüdliche Forschungsarbeit dafür gesorgt, dass wir heute ein so detailliertes Bild unseres Heimatdichters haben.
Insgesamt sind die Veröffentlichungen aus Ihren Reihen, meine Damen und Herren von der
Christian-Wagner-Gesellschaft , ganz beeindruckend:
- Ihr früherer Vorsitzender, Prof. Dr. Burckhard Dücker, hat sich verdient gemacht mit Veröffentlichungen und so zur Sichtbarkeit von Christian Wagner viel beigetragen
- Frau Wieck, die ich aus dem Landtag kenne, hat zum Beispiel an der Veröffentlichung von „Oswald und Klara“ 2018 und bei Anderem maßgeblich mitgewirkt,
- Das „Lauschprojekt“ aus dem Jahr 2010 auf CD von Lutz Schäfer auf Initiative von Herrn Krill, der auch die Musik beigesteuert hat – ganz wunderbar und sehr eingängig auch für interessierte Menschen, die sich Wagner weniger akademisch als vielmehr sinnlich nähern wollen.
- eine Monografie über Nane Wagner von Frau Zeidler von 2019 als eine von vielen „Warmbronner Schriften“.
Das ist jetzt nur ein kleiner Teil der Neuausgaben, Tagungsbände und Warmbronner Schriften, die die CWG herausgegeben hat .
Und für all das musste erst einmal geordnet und archiviert werden!
Ich erinnere mich, lieber Herr Dr. Kollmann, wie ich Sie einmal besucht habe im Wagner-Haus: Sie saßen im 1. Stock vor dicht bestückten Karteikästen und widmete sich unermüdlich der Archivarbeit. Auch Harald Hepfer hat sich, wie ich weiß, sehr verdient gemacht. Hier, meine Damen und Herren, wurde eine leidenschaftliche und tiefschürfende Arbeit geleistet, alles ehrenamtlich, alles aus innerer Motivation und Begeisterung heraus. Alle, die daran mitgewirkt haben, können wirklich stolz darauf sein.
Ich weiß, dass nicht immer alles ganz problemlos war. Aber Sie haben auch viel Unterstützung erfahren, von der Stadt Leonberg oder z.B. von der Arbeitsstelle für literarische Vermittlung bei der Schillergesellschaft in Marbach, die Ihnen immer intensiv zur Seite stand. Ganz besonders bei der Neukonzeption der Ausstellung, die ich überaus gelungen finde in ihrer Sparsamkeit und Eindrücklichkeit. Alles in allem finde ich, dass wir heute auf einen ganz großen Erfolg zurückschauen können, meine Damen und Herren.
Ich weiß nicht, ob den 17 Gründern der CWG am 5. Februar 1972 schon von Anfang an klar war, was sie sich da eigentlich vorgenommen hatten. Fakt ist: Sie haben sich immer wieder durchgekämpft, nicht entmutigen lassen und sind am Ball geblieben– und es hat sich gelohnt!
Sie haben Christian Wagner, der ja an die Wiedergeburt glaubte, tatsächlich zur literarischen Wiederauferstehung und zur Unsterblichkeit verholfen. Sie haben Leonberg und allen, die die Literaturlieben, ein großes Geschenk gemacht:
Vielen herzlichen Dank dafür!