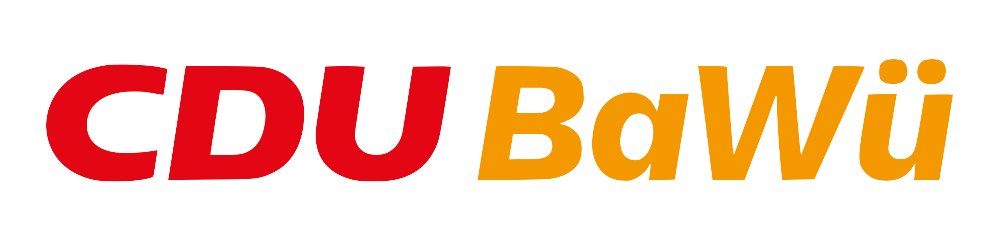Mit dem ersten biobasierte Kunstrasenplatz Baden-Württembergs zeigt der FC Ellwangen, wie Sport und Umwelt in Einklang gebracht werden können – ein Meilenstein für die Bioökonomie im Land.
Kunstrasenplätze sind beliebt – allein in Baden-Württemberg gibt es über 1.000, bundesweit rund 9.000. Bisher wurden sie jedoch meist mit Einstreugranulat aus Gummigranulat von Altreifen befüllt; daneben kamen auch Kunststoffgranulate zum Einsatz. Alle diese Materialien haben einen Nachteil: Sie setzen in großem Umfang Mikroplastik frei. Laut Europäischer Chemikalienagentur gelangen europaweit jährlich bis zu 16.000 Tonnen davon in die Umwelt.
Die Europäische Union hat deshalb die Vorgabe erlassen, dass ab Oktober 2031 solche Kunststoffgranulate nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen. Baden-Württemberg hat frühzeitig reagiert: Seit Juni 2019 fördert das Land keine Kunstrasenplätze mehr mit fossilem Kunststoffgranulat. Unterstützt werden nur noch Systeme ohne Kunststoffinfill oder mit ökologisch unbedenklichen Materialien wie Sand oder Kork.
Der neue Platz in Ellwangen besteht nahezu vollständig aus biobasierten Kunststoffen. Diese Materialien stammen aus nachwachsenden Rohstoffen und sind somit nicht fossilbasiert. Das verwendete Füllmaterial ist biologisch abbaubar. Das bedeutet: Gelangen ausgetragene Partikel in die Umwelt, z. B. durch Wind oder beim Schneeräumen, können sie durch Mikroorganismen in Wasser, CO₂ und Biomasse zerlegt werden. Tests zeigen, dass rund 90 % der Partikel im Boden innerhalb von 24 Monaten, im Wasser sogar innerhalb von 6 Monaten abgebaut werden.
Staatssekretärin Sabine Kurtz betonte bei der Einweihung: „Bioökonomie heißt, fossile Rohstoffe durch intelligente Innovationen zu ersetzen. Mit Projekten wie diesem schaffen wir Mehrwert für Mensch und Umwelt. Ellwangen zeigt, wie Sport nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet werden kann.“ Mit dem neuen Kunstrasenplatz übernehme Ellwangen eine Vorreiterrolle. Der Platz sei ein Leuchtturmprojekt für Nachhaltigkeit, Innovation und Bioökonomie – im Sinne der Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie Baden-Württemberg.