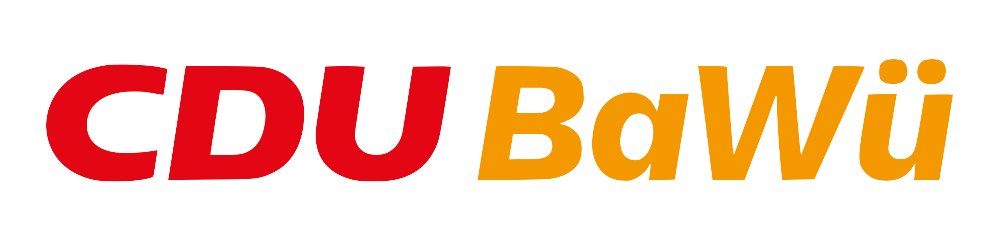Neujahrsempfang der CDU Grafenau am 28. Januar 2024
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich freue mich sehr, dass die CDU hier in Grafenau die Tradition ihrer Neujahrsempfänge fortsetzt. Sehr gerne wünsche auch ich Ihnen ein frohes neues Jahr. Möge das Jahr 2024 ganz viel von dem bringen, was wir uns alle erhoffen. Möge Gottes Segen Sie alle begleiten.
Neujahrsempfänge in Grafenau sind etwas ganz Besonderes. Denn das Dätzinger Schloss, das Malteserschloss hier ist etwas ganz Besonderes. Ein Schloss ist natürlich kein Garant für eine lebenswerte Gemeinde. In einer Demokratie sowieso nicht. Sondern es ist das bürgerschaftliche Engagement, das Grafenau so liebenswert macht. Das kulturelle, sportliche und soziale Miteinander, ein kluger Gemeinderat und
ein erfahrener Bürgermeister, ein starkes ehrenamtliches Engagement, wie z.B. in unserer CDU, Heimatverbundenheit und Weitblick,
Bodenständigkeit und Vernunft – all das finden wir hier in Grafenau.
Aber: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Grafenau profitiert auch von der Wirtschaftsstärke hier in der Region, von Stuttgart, Sindelfingen, Böblingen. Und hier in diesem Wirtschaftsraum erleben wir derzeit eine große Transformation. Es sind momentan viele Veränderungen, die uns mit ihrem Tempo und ihrer Bedeutung den Atem rauben und viele Menschen verunsichern.
Das spiegelt sich auch in der jüngsten Umfrage von Infratest Dimap vom Januar wieder. 56 % der Befragten geben an, dass sie unzufrieden oder beunruhigt sind über die Lage im Land, nur 43 % sind zufrieden mit der Demokratie.
Aber ist es tatsächlich eine grundsätzliche Demokratieunzufriedenheit? Denn 82% der Befragten sind mit der Arbeit der Bundesregierung weniger bis gar nicht zufrieden. Demonstrationen, Kundgebungen und Streiks machen das derzeit sehr deutlich und die Bundesregierung wäre klug beraten, wenn sie ihren schlechten Regierungsstil endlich ändern würde. Deutschland wurde noch nie so schlecht regiert wie von dieser Ampelregierung. Und ich kann mich als CDU-Vertreterin darüber nicht einmal freuen. So fatal ist das alles für unser Land! Denn durch die fehlende Verlässlichkeit, durch dieses Hin und Her schwindet das Vertrauen in die Demokratie. Und das ist fatal für unser Land, gerade angesichts all der Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Wer hätte gedacht, dass wir Krieg vor der eigenen Haustür erleben?
Der Krieg in der Ukraine ist zermürbend, der Krieg in Israel ist furchtbar. Die weiteren Folgen sind noch gar nicht absehbar.
Wer hätte gedacht, dass der Strom wirklich nicht mehr aus der Steckdose kommt, sondern auf dem eigenen Dach oder mit einem Windrad am Gartenzaun produziert werden muss?
Wer hätte geglaubt, dass Intelligenz künstlich hergestellt werden kann?
Wer hätte gedacht, dass im Land des Automobils der Verbrennungsmotor in Frage gestellt wird? Mit allen Folgen für Arbeitsplätze und Wertschöpfung, für unser Ansehen in der Welt!
Deswegen wäre zielführendes, stringentes und nachvollziehbares Regierungshandeln so dringend notwendig.
Letzte Woche hatten wir in der CDU- Landtagsfraktion ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Mercedes-Benz Group, mit Ola Källenius. Gestern war die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie bei der CDU-Klausur in Kloster Schöntal. Beide brachten klar zum Ausdruck, dass die steigenden Energiepreise und der ehrgeizige Weg hin zur Klimaneutralität unsere Wirtschaft vor enorme Herausforderungen stellen.
Källenius erinnerte daran, wie das I-Phone den Blackberry überholte. Anfangs wollte er selber nicht glauben, dass man einen Text auf einer Glasscheibe tippen könnte. Auch ich habe lange an der alten Tastatur festgehalten. Aber die Entwicklung hat uns überholt. Die Entwicklung hat Blackberry überholt. Dieses Gerät ist vom Markt verschwunden. Das sollte uns mit der deutschen Autoindustrie nicht passieren!
„Zu wechseln von dem, was ist, zu dem, was kommt“ sei die einzige Tradition, die in seinem Geschäft zählt, sagte Källenius. Die Politik habe das Aus des Verbrennungsmotors vorgegeben. Und da momentan keine andere Technologie marktreif zur Verfügung stehe, müsse sich die Automobilindustrie jetzt eben auf Elektroantriebe einstellen. Er sagte das ganz emotionslos und ohne Vorhaltungen, meine Damen und Herren.
Man werde sich zwar bis in die 2030er Jahre auch für andere technologische Optionen offen halten, aber im Moment sei das E-Auto die Lösung und ein Konzern müsse Geld verdienen. Kapital sei kein Wähler. Da geht es in der Wirtschaft ganz eindimensional zu – anders als in der Politik. Kapital schaue einfach auf das Verhältnis von Risiko und Rendite und wandere frei dahin, wo das beste Verhältnis liege – und das kann durchaus außerhalb von Baden-Württemberg, von Deutschland und von der Eu sein – fatal für uns auch hier in Grafenau.
Meine Damen und Herren,
diese Logik, etwas mehr Logik würde uns allen gut tun.
Im Jahr des 300. Geburtstags von Emanuel Kant, dem großen Philosophen der Aufklärung, täte es unserer Gesellschaft gut, wenn wir uns insgesamt wieder stärker der Vernunft zuwenden würden. Trotzig mit dem Fuß aufstampfen, Politiker in Panik versetzten wollen (Greta Tunberg), sich auf die Straße kleben – das bringt doch alles überhaupt nichts. Machen, tun, handeln – das ist das Gebot der Stunde. Und zwar etwas schneller, als wir uns das in Deutschland in letzter Zeit angewöhnt haben. Das gilt gerade auch für die Bundesregierung. Etwas unbürokratischer, pragmatischer. Das wäre echt sinnvoll und hilfreich. Auch und gerade in der EU.
Dazu kann aber auch die Gesellschaft etwas beitragen.
Z.B, in dem wir jetzt nicht jedes einzelne Windrad und speziell das in der Nähe des eigenen Wohnorts in Frage stellen. Dass wir auch mal in die Fachleute vertrauen, in ihre Expertise und ihr Verantwortungsbewusstsein.
Wir in der CDU stehen
für sinnvollen Pragmatismus,
für tatkräftiges Handeln,
und zwar in Verantwortung vor Gott und den Menschen, wie es im Grundgesetz steht.
So wünschen wir uns auch die Europäische Union,
liebe Andrea Wechsler. Deswegen bist Du in Baden-Württemberg unsere Spitzenkandidatin. Damit Du diese Position und diese Haltung im Europäischen Parlament stark und deutlich vertrittst. Du kannst dort gerne berichten, dass wir in Baden-Württemberg kluge Gemeinderäte und tüchtige Bürgermeister haben,
die genau wissen, was die Menschen hier bei uns brauchen und wie man die Dinge anpacken muss.
Wenn wir so beherzt vorgehen, dann nehmen wir auch automatisch denen den Wind aus den Segeln, die den Leuten ihr Stahlblau vom Himmel herunter versprechen,
in Wirklichkeit aber Hass und Hetze verbreiten und meinen, es ginge uns ohne Freiheit und ohne Demokratie besser.
Wenn wir so beherzt handeln, dann müssen wir auch nicht mehr unsere Zeit bei Demonstrationen verbringen, um diesen Demagogen die Stirn zu bieten.
Wenn wir so beherzt vorgehen,
dann können wir uns ganz vernünftig und zuversichtlich den Zukunftsaufgaben widmen:
– Der Ernährungssicherung durch unsere heimische Landwirtschaft
– Dem Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen
– Dem Ausbau der verschiedenen regenerativen Energien
– Forschung und Entwicklung zur Lösung der technologischen Fragen
– Der Digitalisierung und dem Umgang mit Künstlicher Intelligenz
– Dem Familienzusammenhalt,
– Der Integration
– der Bildung und
– dem Sozialstaat.
Meine Damen und Herren, ich weiß, dass die meisten von Ihnen, die heute hier versammelt sind, ihren Beitrag zu unserem Gemeinwesen leisten, jeder an seiner Stelle, jeder nach seinen Kräften. So können wir es schaffen, meine Damen und Herren. Gemeinsam können wir das vor uns liegende Jahr gut meistern. In 2024 haben Sie wieder mehrfach die Gelegenheit, von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch zu machen,
bei den Kommunalwahlen (Ortschaftsrat, Gemeinderat, Kreistag und Regionalversammlung) und bei der Europawahl am 9. Juni. Nehmen Sie Ihr Wahlrecht bitte wahr! Denn: Demokratie funktioniert nicht ohne Demokraten!
Viele von Ihnen stellen sich ja auch selber als Kandidaten zur Verfügung. Weil sie der Gesellschaft dienen wollen, weil sie mitmischen und gestalten wollen,
weil sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen,
weil Sie es ernst meinen mit Frieden und Freiheit, mit Wohlstand und Gemeinsinn. Dafür danke ich Ihnen allen sehr herzlich, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Packen wir es an – es gibt viel zu tun!